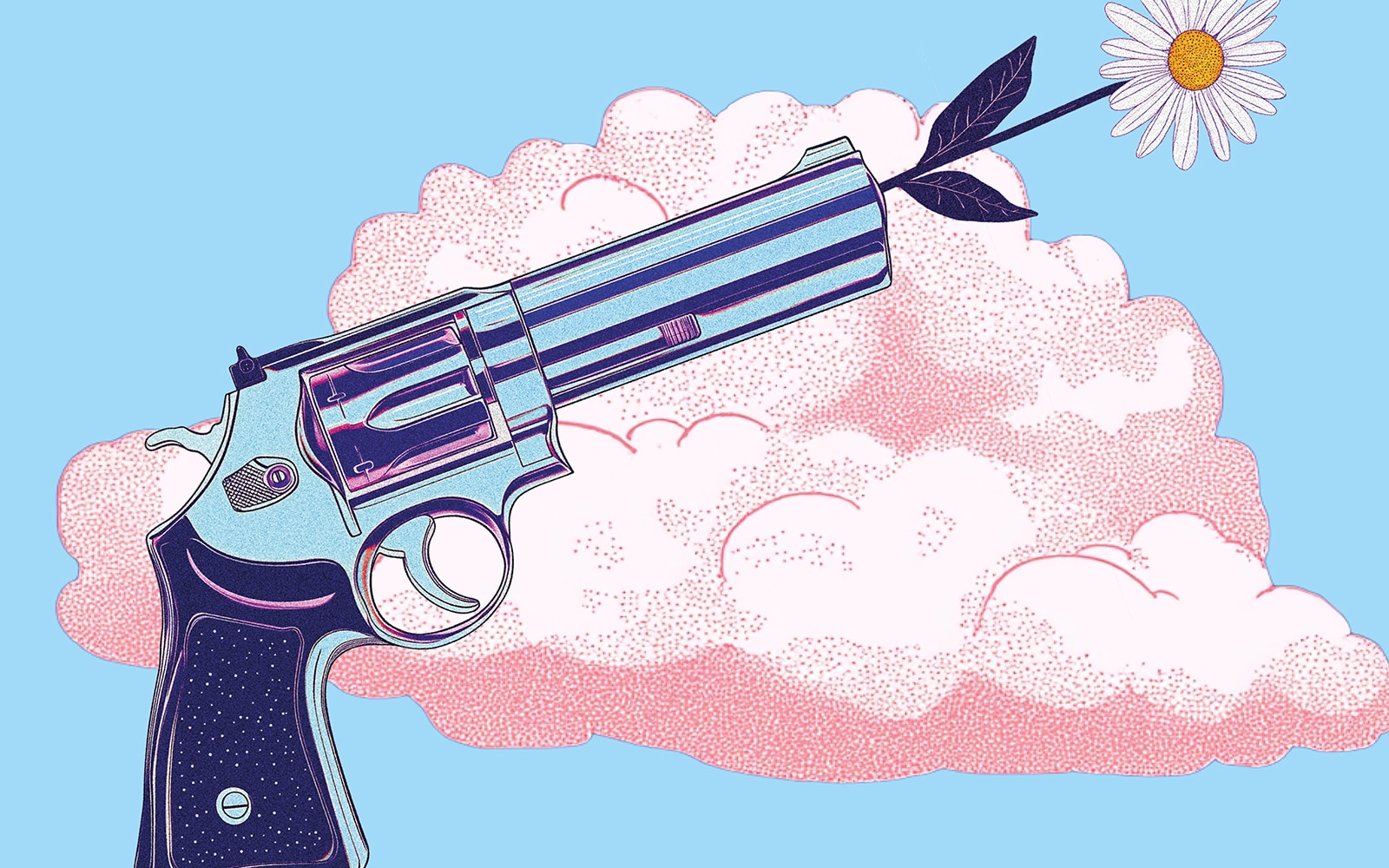Hoffnung schafft Mut und Demut, sagt die Theologin Heike Breitenstein. Sie muss es wissen, denn sie beschäftigt sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Thema. Zudem lebt sie Hoffnung praktisch – als Teil der Gemeinschaft Stadtkloster Frieden in Bern.
Krieg, Krisen, Klimawandel: Negativschlagzeilen scheinen die Welt zu dominieren. Wie erlebst du die aktuelle Stimmung?
Der Fortschrittsoptimismus ist verschwunden. Viele Menschen blicken ängstlich in die Zukunft. Vor allem Jüngere sorgen sich wegen des Klimawandels. Sie fühlen sich wie auf einem sinkenden Schiff – das nicht einmal mehr zu retten ist, wenn man mit voller Kraft rudert. Einige reagieren mit Aktivismus und versuchen, das Steuer herumzureißen. Früher oder später enden sie in der Erschöpfung oder der Resignation. Andere „privatisieren“ ihre Hoffnung. Sie ziehen sich zurück, konzentrieren sich aufs persönliche Glück.
Deine Doktorarbeit dreht sich ums Thema „Hoffnung“. Was hat dich bei der Recherche überrascht?
Je tiefer ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr merke ich, dass Hoffnung ein zentrales Element des christlichen Glaubens ist. Im christlichen Dreiklang aus Glauben, Liebe und Hoffnung übersehen wir das aber oft. Hoffnung ist die vernachlässigte kleine Schwester des Glaubens. Blicken wir auf die Geschichte der ersten Christinnen und Christen zurück, erkennen wir eines: Sie zeichneten sich durch ihre unerschütterliche Hoffnung aus. Diese machte ihre Mitmenschen nachdenklich und neugierig. Leider sind wir heute nicht mehr so geübt darin, unsere christliche Hoffnung zu kommunizieren.
Die ersten Christinnen und Christen stießen auf erbitterten Widerstand bis hin zu brutaler Verfolgung. Um dennoch am Glauben festzuhalten, brauchte es schon ein starke Dosis Hoffnung!
Auf jeden Fall. Je schwieriger die Umstände, desto stärker ist der Blick auf die Hoffnung – und eine große Frage kommt auf: Gibt es etwas jenseits unseres Lebens? Zum Beispiel eine Gerechtigkeit für die Opfer dieser Welt? Solange wir auf der Siegerseite stehen, beschäftigt uns dieser Gedanke kaum.
Worauf gründet die christliche Hoffnung?
Auf Jesus. Er ist die Hoffnung in Person. Für Christinnen und Christen ist es ganz zentral, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und wir heute mit ihm in Kontakt kommen können. Dieser Jesus verspricht, dass er wiederkommen und alles neu machen wird. Christliche Hoffnung bezieht sich auf die Auferstehung der Toten und auf Gottes neue Welt. Diese neue Welt schließt Gerechtigkeit und Friede ein und bringt Mensch und Natur in Balance.
Schlechter sieht es aus, wenn ich nicht an die Auferstehung von Jesus glaube …
Ja, aber ich bin überzeugt, dass die Auferstehung Jesu mehr ist als eine Idee. Es ist ein historisches Ereignis. Ich bin den Indizien dafür nachgegangen. Und eine solche Spurensuche empfehle ich allen. Im Pontes Institut beschäftigen wir uns intensiv mit den Argumenten für den christlichen Glauben. Denken und Glauben sind für uns kein Widerspruch. Sie ergänzen einander.
Viele Führungskräfte haben Mut, große Pläne und eine volle Agenda. Sie sprühen voller Tatendrang und verschwenden kaum Gedanken an ein Jenseits.
Tatsächlich ist es so, dass Menschen meist erst über existenzielle Fragen nachdenken, wenn sie in Krisen schlittern, ihre Karriere ins Stocken gerät oder sie Schicksalsschläge erleiden. Aber was mich fasziniert, ist, dass die Hoffnung viel mehr ist als eine „Glückspille“ für Stimmungstiefs. Sie erfüllt mein Leben jederzeit und eröffnet mir Perspektiven. Zum Beispiel bei der Sinnfrage. Da macht die christliche Hoffnung mutig und demütig. Mutig, weil ich mich einsetzen darf, um die Welt nach Gottes Maßstäben zu gestalten. Was wir in „Glaube, Liebe und Hoffnung“ tun, überdauert dieses Leben. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass ich nicht die Retterin der Welt bin. Das entlastet. Gott kommt, rettet und verwandelt die Welt. Wann immer Leute gemeint haben, sie könnten das Reich Gottes oder die perfekte Gesellschaft selbst aufbauen, sind ihre Anstrengungen in Terror und Gewalt ausgeartet. Deshalb ist die Kombination von Mut und Demut so wichtig.
Angenommen, ich bin auf der Erfolgsspur. Was kann mir denn Gott und der Glaube noch bringen?
Es geht nicht nur darum, ob mir etwas emotional guttut. Auch für Überfliegerinnen und Überflieger ist es spannend, die Perspektive zu erweitern. Letztlich ist es ein urmenschliches Bedürfnis, die Welt zu verstehen – auch wenn wir das oft lieber verdrängen. Und da bietet der christliche Glaube sehr überzeugende Antworten.
Auf vielen Teppichetagen sind Spiritualität und Achtsamkeit angekommen. Mit dem Christentum gibt’s aber Berührungsängste.
Das Fremde ist für uns oft spannender. Viele Leute denken, sie seien mit dem Christentum ausreichend vertraut. Dabei schlummern in unserer eigenen Tradition viele Schätze, die es zu entdecken gilt!
Welche praktischen Schlüsse ziehst du aus deiner Hoffnungsforschung?
Eine meiner Kernthesen steht fest: Wenn wir den christlichen Glauben verständlich vermitteln wollen, muss die Hoffnungsdimension eine entscheidende Rolle spielen. Statt uns defensiv zurückzuziehen, sollten wir die Hoffnungskraft bezeugen. Der Literaturwissenschaftler und Bestseller-Autor C.S. Lewis meinte, wie müssten die „bessere Geschichte“ erzählen. Das Evangelium überzeugt rational, aber auch emotional. In dieser Geschichte hat jede und jeder seinen Platz – darf klagen, hoffen und mutig handeln. Als Individuum bin ich mit anderen in einer Hoffnungsgemeinschaft drin – unterwegs zu einer anderen Welt, die von Gott kommen wird.
Klingt gut – aber eben auch wie ein Vertrösten aufs Jenseits!
Ja, ich finde, Religionskritiker wie etwa Friedrich Nietzsche haben zurecht beanstandet, dass einige Kirchenvertreter Unrecht nicht benannt, sondern die Leute auf den Himmel vertröstet haben. Unter diesem theologischen Deckmantel wurde Missbrauch betrieben. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat klargestellt, dass Christinnen und Christen zur Treue zur Erde berufen sind. Er betonte, dass Gott diese Welt erneuern wird. Die christliche Hoffnung wendet sich also nicht von dieser Welt ab, um auf eine andere zu spekulieren. Wer auf Gott hofft, setzt sich für diese Welt ein. Für diese Überzeugung bezahlte Bonhoeffer im Nazi-Reich mit seinem Leben.
Welche weiteren Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger beeindrucken dich?
Zum Beispiel der Bürgerrechtler Martin Luther King. Ihn trieb Gottes Vision für diese Welt an. Das gab ihm Kraft, für Gerechtigkeit und Menschenwürde zu kämpfen und sich gegen Rassismus zu stellen. Martin Luther King gab den Leuten Hoffnung und zeigte, dass Veränderungen möglich sind. Auch in unserem Umfeld finden sich Menschen, die zu einem Wandel beitragen. Ich denke an Menschen, die hier in Bern ein kleines Start-up gegründet haben. „Teil dein Style“ ist ein nachhaltiges Projekt – eine Bibliothek für Kleidung. Die Idee ist, sich Kleider zu leihen, statt sie zu kaufen. Die Initianten geben sich nicht damit zufrieden, dass Mensch und Natur durch die Bekleidungsindustrie ausgebeutet werden. Atheisten könnten nun sagen: „Die Welt ist so schlecht. Es kann keinen Gott geben.“ Aber Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger setzen die Welt ins Unrecht. Sie sind Lernverweigerer. Sie passen sich nicht dieser Welt an, sondern passen die Welt Gottes Maßstäben an.
Wer ein Unternehmen gründet, braucht Hoffnung. Kannst du aus deiner Forschung einige Tipps fürs Unternehmertum ableiten?
Hoffnung richtet sich immer nach vorn. Man überlegt sich, wie die Welt von morgen aussehen und was man dazu beitragen könnte. Wer eine starke Vision entwickelt, kann diese auch Mitarbeitenden aufzeigen. Das motiviert sie, sich kreativ und innovativ einzusetzen. Darüber hinaus braucht Hoffnung immer eine starke Gemeinschaft. Ein Team von Leuten, die sich gegenseitig ermutigen, die spüren, dass sie einen Unterschied machen können. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit stärkt die Hoffnung.
Kann eine Führungskraft neue geistliche Ressourcen entdecken – ohne deinen christlichen Glauben zu teilen?
Spannend ist, sich auf die Spuren der Weisheitstraditionen zu machen. Diese Reise habe ich selbst unternommen und erfahren, dass im christlichen Glauben immense Schätze verborgen sind. Der katholische Philosoph Josef Pieper sagte einmal, es gebe zwei Gegenpole gegen die Hoffnung: die Verzweiflung und die Vermessenheit. Die Verzweiflung gibt auf und endet in absoluter Resignation. Die Vermessenheit ist der Aktivismus. Ich glaube, Hoffnung braucht Aktivität, ohne aktivistisch zu sein. Gleichzeitig benötigt sie einen realistischen Blick auf die Sachlage, ohne von vornherein aufzugeben. Diese Haltung hilft allen, unabhängig von ihrer Weltanschauung. Ganz praktisch liefert die Bibel auch Weisheit zum menschlichen Miteinander. Wie sollen wir Mitarbeitende führen? Wie gehen wir mit Scheitern und Versagen um? Für mich ist ganz entscheidend, dass in Niederlagen nicht das Ende liegt, sondern der Gott der Hoffnung dadurch immer wieder Neues schaffen kann.
In unserer Kultur schreiben wir Menschen, die auf die Nase fallen, oft ab. In der US- oder israelischen Startup-Szene ist das anders. Dort sagt man: „Die Person ist um eine Erfahrung reicher.“ Müssten unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft umdenken?
Gerade bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, lässt sich oft beobachten, wie sie nach einem Fehltritt wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen werden. Dabei sollten wir aus dem Christentum heraus wissen, dass wir nicht davon leben, Fehler zu vermeiden, sondern daraus, Fehler zuzugeben und Vergebung zu erfahren – und neu durchzustarten. Wenn wir zu perfektionistisch unterwegs sind, führt dies oft zur Heuchelei. Wir vertuschen Fehler, wischen alles unter den Teppich und spielen uns gegenseitig etwas vor. Der christliche Glaube lädt uns ein, authentisch zu sein.
Nichtsdestotrotz bescheinigt unsere Gesellschaft gemäß der Studie Hoffnungsbarometer der Kirche kein großes Hoffnungspotenzial. Ist da was schiefgelaufen?
In letzter Zeit sind erschütternde Skandale in Kirchen und in christlichen Organisationen ans Licht gekommen. Das ist schrecklich. Doch was sagte Jesus? Er hat Gewalt und Heuchelei verurteilt, sich für die Unterdrückten und Schwachen eingesetzt. Daran müssen sich Kirchen und christliche Gemeinschaften orientieren. Als Christinnen und Christen sind wir nur dann eine Hoffnungsquelle, wenn wir glaubwürdig leben. Echte Gemeinschaft entsteht, wenn Menschen Annahme und Nächstenliebe erfahren, Barrieren verschwinden und Generationen, Kulturen und Milieus sich gegenseitig bereichern. In solchen Gemeinschaften können Menschen Hoffnung für ihr persönliches Leben schöpfen, aber auch für die Gesellschaft und für die Welt.
Was hilft dir persönlich in Krisen?
Die Klage ist für mich die Schwester der Hoffnung. In der Klage protestiere ich gegen Leid und Ungerechtigkeiten in der Welt und flehe Gott an, dass er eingreift, sich erbarmt, etwas unternimmt. Das wiederum schenkt mir Hoffnung. Das habe ich schon mehrfach erlebt. Mir hilft die Klage, nicht einfach die Augen zu schließen und mich ins positive Denken zu verkriechen. Ich mache mir nicht vor, dass alles halb so schlimm ist, sondern stelle mich den Tatsachen schonungslos. Aber ich kann mich in meinem Schmerz an jemanden wenden, der mich versteht – an Jesus. Er weiß, wie sich Leid anfühlt. Und ich glaube, dass er die Welt und mein Leben in seiner Hand hat.
Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“. Wie ordnest du das ein?
Luther geht davon aus, dass dem Ende der Welt ein Neubeginn innewohnt. Also dass Gott etwas aus
dem Nichts schafft und aus dem Tod neues Leben macht. Es beeindruckt mich, dass Christinnen und Christen in den großen Krisen, in Pandemien und Kriegen, immer an der tätigen Liebe, am Einsatz für die Welt und am Gebet festgehalten haben. Darin möchte ich mich einreihen. Der Einsatz für die Welt und das Gebet gehören zusammen. Im Gebet tanke ich Kraft, lasse mich berühren und füllen von Gottes Geist. Das Gebet stärkt mich dann für den Einsatz in dieser Welt. Und es hilft mir, den Blick von mir wegzunehmen und auf Gott zu richten – ganz im Sinn der klösterlichen Tradition von Beten und Arbeiten. Frère Roger, der erste Prior und Gründer von Taizé, hat gesagt: „Wer Vertrauen hat, geht der Verantwortung nicht aus dem Weg, sondern kann aufrecht stehen bleiben, wo die Gesellschaft aus den Fugen gerät.“